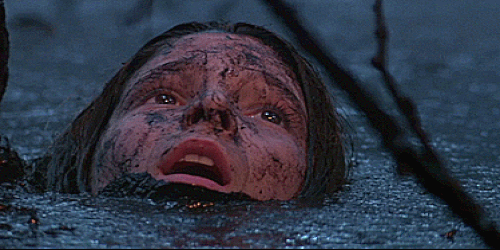Auf der anderen Seite des verlassenen Schreins wo die Birken und Weiden nicht so dicht stehen, und auch das dornige Gestrüpp im Unterholz dünner ist, bahnen sich die drei erschöpften Gefährten ihren Weg weiter nach Osten. Trotzdem kommen sie nicht wirklich gut voran, da die hüfthohen Farne, die aus der fetten Erde emporwachsen, sich überall wuchernd ausbreiten. Sie erreichen schließlich einen unebenen, steinigen Untergrund mit von schmierigen Flechten überzogenen Felsblöcken. Die Äste der hohen Bäume des Waldes breiten sich wie ein dunkles Gewölbe über ihnen aus.
Langsam kämpfen sie sich Schritt für Schritt über das feuchte, moosbewachsene Geröll, zwischen den von Wurzeln umwucherten Findlingen vorwärts. Obwohl das Unterholz weniger dicht steht ist die Sicht ob des Regens hier auch nicht besser. Der Boden ist auch nicht weniger gefährlich, und Praiala muss
um nicht auf den glitschigen Steinen abzurutschen.
Als die Geweihte einen plötzlichen Schmerzensschrei hinter sich hört erkennt sie im Licht ihrer Laterne Quin hinter ihr auf dem Geröll liegen. Offenbar ist sein Bein eingeknickt, das Knie ist verdreht und er stöhnt als er sich mit Ron's Hilfe wieder aufrichtet.
Besorgt kniet sich Praiala neben ihn und
das Bein welches vor Schmerz unkontrolliert zittert.
"Du hast dir das Knie verdreht. Wenn wir so weiter gehen wird es anschwellen und vielleicht bald steif werden. Wir könnten mit einem Ast eine behelfsmäßige Krücke anfertigen.", erklärt die Geweihte.
Mit einem erneuten Gebet zu Praios und Peraine erbittet sie einen
. Ob der Götterverlassenheit des verfluchten Landes erwirkt ihr Gebet jedoch keine heilende Wirkung. Ron, der seinem Freund inzwischen einen Ast als Krücke abgebrochen hat, stützt ihn während sie weiter durch das unwegsame Gelände humpeln. Die Geweihte stapft den beiden voran, leuchtet mit der Laterne voraus und sucht einen Weg aus dem gefährlichen Geröllfeld.
Nach der felsigen Fläche erreichen sie erneut dichtes Gehölz. Seit sie den Schrein verlassen haben, versperrt ihnen überall dichtes Blattwerk den Blick auf den nachtschwarzen Himmel.
Als sie vor einem umgestürzten Baumriesen anhalten und mit den Lampen die Umgebung ableuchten plädiert Ron dafür anzuhalten, weil sie nur sehr langsam durch den Wald vorankommen. Noch immer sind sicherlich fünf Meilen der verfluchten Brache vor ihnen, aber Ron und Quin sind längst schon an ihre Grenzen gestoßen. Zweimal hatte Quin sich seit dem Geröllfeld mitten im Wald hingesetzt, schweigend, unwillig und unfähig, noch weiterzulaufen. Seine Bewegungen sind immer weniger zielgerichtet und immer unkoordinierter, so als sei er betrunken. In gewisser Weise ist er das auch, er ist betäubt vor Erschöpfung.
"Ich kann nicht mehr weiter.", sagt er schließlich.
Praiala und Ron sitzen dicht nebeneinander unter dem schmalen Vordach des Zeltes und sehen zu, wie beißender Rauch von den feuchten Holzstücken ihres kleinen Lagerfeuers aufsteigt. Mit dem feucht-modrigen Gehölz ließ sich trotz aller Bemühungen nicht viel anfangen und so mussten sie Lampenöl verwenden um es überhaupt zu entzünden. Der Regen hatte sich mittlerweile in ein feines Nieseln verwandelt und erneut breitet sich Nebel aus. Mit jeder Minute, die vergeht, während sie darauf warten, dass das Feuer endlich ein wenig Wärme spendet, wird es schwieriger ihre Füße zu erkennen oder den Ort, wo sie den Rucksack hingestellt haben.
An der Stelle, wo sie ihr Lager aufgeschlagen haben, ist der Waldboden übersät mit zerbrochenen Ästen. Es war beinahe unmöglich gewesen, hier ihr Zelt zu errichten. Bevor sie es aufbauen konnten, mussten sie erst einmal den Platz säubern. Praialas Finger sind wund, weil sie so viele abgestorbene Äste und Zweige beiseitegeräumt hatte, um eine kleine Fläche halbwegs frei zu bekommen. Nun steht das kleine Zelt irgendwie schlaff und schief da, besser haben sie es nicht hinbekommen. Unter dem Zeltboden sind noch immer jede Menge Wurzeln, Nesseln und Farne zu sehen, so dass man sich kaum vorstellen kann, an dieser Stelle auch nur einigermaßen bequem liegen zu können.
Ron geht davon aus, dass es eine schlimme Nacht werden wird. Irgendwie werden sie sie zusammengerollt oder in einer Ecke des Zweimann-Zeltes hockend überstehen. Immerhin wird es drinnen trocken sein, jedenfalls hofft er es. Von der Hüfte abwärts sind sie alle völlig durchnässt. Praialas Oberschenkel sind von der wattierten Unterkleidung wund gescheuert. Sie schiebt den nassen Stoff ganz vorsichtig bis zu den Knien, fürchtet aber, dass sie sie nicht mehr anbekommen würde, deshalb zieht sie sie lieber nicht ganz aus.
Quin liegt im Zelt in Praialas Schlafsack und schweigt.
Auf dem Fußende der daneben ausgebreiteten Wolldecke liegt ihre restliche Ausrüstung.
Zehn Minuten lang sitzen sie schweigend da und starren in die Dunkelheit.
Langsam fühlt Praiala wie die Erschöpfung durch die gewaltige Anstengung des Marsches sie übermannt.
Immerhin haben sie das Zelt an einer Stelle aufbauen können, die besser aussieht als alles, was sie in den letzten Stunden hinter sich gebracht haben. Hier sind sie einigermaßen geschützt vor den eisigen Luftströmen, die zwischen den Bäumen wehen, und haben einen halbwegs festen Untergrund, nachdem sie einen Großteil des morschen Geästs beiseitegeräumt haben. Als das Zelt aufgebaut war, machte Praiala sich daran, ein Lagerfeuer zu entzünden.
Sie sind viel zu müde, um sich zu unterhalten. Und sehen sich nicht einmal mehr an.
Die Geweihte hat sich in den vergangenen Stunden völlig verausgabt. Ihre Oberschenkel tun weh, in ihrem Gesäß pocht ein stechender Schmerz. Sie fragt sich, wie weit sie wohl gekommen wäre, wenn sie sich von den anderen getrennt hätte. Mindestens doppelt so weit. Würde ihre Prüfung nun daraus bestehen diese beiden Narren aus der Brache zu schleppen? Vielleicht hätte sie alleine mehr erreicht. Wer weiß? Als sie diesen grässlichen Schrein endlich hinter sich gelassen hatten, wäre sie den anderen am liebsten davongelaufen. Jeder Augenblick des Leidens, den sie ertragen muss, speist ihre Abneigung gegen Ron und Quin, die daran schuld sind, dass sie nun vor der Kommission des Illuminaten darlegen muss, dass sie sich mit nichten dämonischem Wirken gestellt hatte, sondern der Dummheit zweier verirrter Schatzsucher.
Gleich beim ersten Licht des Tages werden sie aufbrechen. Sie werden den Kompass nehmen und sich direkt nach Osten aufmachen. Nachdem sie einige Stunden geschlafen haben. Sie werden einfach immer weitergehen, egal durch wie viel Dornicht und Sumpflöcher sie sich kämpfen müssen, trotz der Angst und des Schreckens, immer dem Ziel entgegen. Praios wird ihnen beistehen.
Durch die Öffnung des Zeltes kann sie sehen, wie Quin schweigend daliegt, das verletzte Bein auf den Rucksack gelegt, um die Schwellung zu lindern.
Ron nickt und seufzt. Dann schaut er hinauf in das dunkle Blätterdach und zu den dicken feuchten Ästen, unter denen sie ihr Lager errichtet haben. Die Zweige dort oben verbinden sich zu einem tiefschwarzen Dach. Wasser tropft ihm ins Gesicht. Einige wenige dicke Tropfen klatschen gelegentlich in ihrer Nähe auf die Erde. Das Wasser findet immer einen Weg zu ihnen.
Aus dem Zelt hören sie Quin's Stimme.
"Es tut mir leid, Kumpel. Wirklich, das ist mein Ernst. Die ganze Sache. Das war einfach … völlig daneben."
Eine ganze Weile antwortet Ron nicht. Und mit jeder Sekunde Schweigen wird die dicke Luft im Lager noch undurchdringlicher. Als er reagiert, klingt seine Stimme ganz ruhig.
"Das stimmt. Aber deine Entschuldigung kannst du dir in den Arsch schieben. Ich will nichts davon hören. Wenn es nicht unmittelbar mit unserem Überleben zu tun hat, dann möchte ich kein einziges Wort mehr mit dir wechseln bis wir hier wieder raus sind."
Praiala wirft Ron einen Blick zu. Der verzieht das Gesicht und wendet sich ab.
Quin schnarcht im Zelt vor sich hin. Es klingt kaum noch menschlich, eher wie eine Maschine. Das ist kein Geräusch, an das Praiala sich gewöhnen könnte. Sie sitzt neben Ron mit ihrer Sturmlaterne unter dem Vordach des Zeltes. Das Lagerfeuer hatte nicht lange gehalten, und Wärme gespendet hatte es auch nicht.
Sie seufzt und starrt das feuchte Glasfenster der Laterne an. Es ist das einzige Ding, das ihr noch etwas Angenehmes bieten kann inmitten dieses Waldes, in dem es so dunkel ist wie am Grund des tiefsten Ozeans. Wenn man zu sehr ins Dunkel schaut und versucht, in dem Nichts irgendwelche Formen auszumachen, kann man völlig die Orientierung verlieren. Um sie herum pladdert der Regen herunter.
Praiala hat sich in sich zurückgezogen und wird von nur allzu vertrauten Gedanken heimgesucht. Warum wollen manche Menschen, so wie Ron und Quin, es einfach nicht wahrhaben, dass der Platz der ihnen von Praios in seiner unendlichen Weisheit in dieser Welt zugewiesen wurde, der ihre ist. Sie versuchen mit Diebstahl, Betrug, oder Schlimmerem ihren Mitmenschen das wegzunehmen für das diese im Schweiße ihres Angesichts schwer gearbeitet haben. Und für solche Menschen riskiert sie ihr Leben? Setzt ihre Chance in die Heilige Inquisition berufen zu werden aufs Spiel?
Dann sieht sie plötzlich Gesichter vor sich. Halb verhungerte, schmutzige Straßenkinder aus dem Südquartier. Um ein Stück Brot bettelnd im Dreck und Unrat der Straße.
Kriegsversehrte, Kranke und Krüppel.
Wie schon so oft verbeisst sie sich in die ungelösten Fragen ihres Lebens. Wenn sie könnte würde sie das gesamte Leid der Welt tilgen.
Sie fragt sich wieso sie zweifelt. Liegt es daran, dass sie als Abenteurerin durchs Land gereist ist anstatt sich ganz den Pflichten einer Priesterin im Tempel zu widmen? Hat sie ihren Auftrag, den Glauben an Praios zu verbreiten erfüllt? Den Glauben an die Gerechtigkeit, die himmlische Ordnung auf Dere und die Demut sich seinem Schicksal und der Herrschaft Praios' zu ergeben?
Die ganze Schwere der letzten Jahre drückt sie nieder, das Leiden des Orkensturms, die Belagerung Greifenfurts.
Auch ihre Erfolge im Kampf gegen die Umtriebe der Anhänger des Namenlosen Gottes helfen ihr nicht, ihren Schmerz, ihre Vergänglichkeit, ihre Desorientierung, ihre Fehlschläge und Fehler zu ertragen. Und sie gesteht sich ein, dass sie sich immer nach einer Familie gesehnt hat, wie viele ihrer ehemaligen Kollegen sie haben, nach einem Heim, einer Karriere und einem scheinbar zufriedenen Leben. Ohne diese Dinge, das war ihr vor ein paar Jahren schon klar geworden, könnte man auch nicht im Entferntesten hoffen, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Nicht ernsthaft, nicht in dieser Welt, nicht wenn man aus dem jugendlichen Alter herausgewachsen ist. Aber gleichzeitig verachtet sie sich auch dafür, dass sie sich danach sehnt, das zu bekommen, was ihre ruhigeren Kollegen haben, diese scheinbare Sicherheit, die vielen so selbstverständlich vorkommt. Sie verachtet sich dafür, dass sie sich danach sehnt, akzeptiert zu werden, weil sie doch gleichzeitig weiß, wie überflüssig sie sich in solchen Aufgaben und Stellungen vorkommt. Aber trotzdem sehnt sie sich danach. Das ist wohl der Kern ihrer unseligen Existenz, ihrer Verzweiflung. Wahrscheinlich wird sie sterben, ohne je ein normales Leben erreicht zu haben, unfertig und enttäuscht.
Plötzlich wird sie von einem lauten Krachen aus ihren Gedanken gerissen. Irgendwo dort draußen, inmitten der endlosen ungeordneten Reihen der Bäume und dem Meer von verrottendem Holz und undurchdringlichem Gestrüpp, ist ein großer Ast oder ein ganzer Stamm offenbar auseinandergebrochen. Der brutale Klang dieses mächtigen Zerberstens scheint sich in alle Richtungen zu verbreiten. Es ist praktisch unmöglich herauszufinden, wo dieses Geräusch seinen Anfang genommen hat.
"Bei Praios, hab ich mich erschreckt."
Ron, der neben ihr sitzt, atmet heftig aus.
"Ich mich auch."
"Das hab ich schon mal gehört. Vor dieser Hütte.", erklärt Praiala,
"Das war nur ein Ast, der runtergefallen ist."
"Meint ihr?", fragt Ron.
"Morsche Äste saugen sich mit Wasser voll und brechen ab."
Nach zehn Minuten Stille steht Ron stöhnend auf. Er scheint durch Praialas Worte überzeugt zu sein, dass keine Gefahr besteht. Die Geweihte selbst ist sich da jedoch nicht so sicher, will sich aber nichts anmerken lassen. Sie wundert sich, dass Ron ganz ruhig sagt:
"Habt vielen Dank für Alles, ohne euch wären wir verloren! Ich lege mich jetzt hin. Ich brauche dringend etwas Schlaf."
Wenig später hört die Geweihte das Schnarchen der beiden Männer während sie weiter gegen die Müdigkeit und die Überanstrengung ankämpft.
Erneut vernimmt sie etwas ungewöhnliches. Aber die nachfolgende Serie von Geräuschen wird nicht von einem Baum verursacht und ähnelt auch nichts, das sie bisher in diesem oder irgendeinem anderen Wald gehört hat. Es ist eine Mischung aus ochsenartigem Keuchen und dem Bellen eines Schakals, aber so tief und kraftvoll, dass man sich ein viel größeres Tier mit einem viel mächtigeren Brustkorb und riesigem Maul vorstellen muss. Eine Bestie, etwas Wildes, dem man besser aus dem Weg geht. Das Geräusch wiederholt sich. Ungefähr zwanzig Meter von ihnen entfernt. Aber man kann nichts hören, was darauf hindeutet, dass sich da etwas bewegt.
Es ist garantiert ein Tier, etwas Großes. Praiala weiß, dass die Dunkelheit ganz natürliche Geräusche verfremden und verstärken kann. Sogar eine kleine Kröte kann mitunter gigantisch wirken und kilometerweit gehört werden. Ein Vogelruf kann mit einem menschlichen Schrei verwechselt werden, und im Lockruf eines Säugetiers kann man bisweilen Wortfetzen der menschlichen Sprache entdecken.
Was war das?
Und da ist es wieder, das eigenartige Geräusch. Viel näher jetzt, aber es scheint nun hinter Praialas Rücken zu sein und nicht mehr vor ihr, als hätte es geräuschlos ihr Lager umkreist.
Sie richtet die Sturmlaterne auf die umstehenden Bäume. Der Lichtkegel wird von dem dicken feuchten Blattwerk und Geäst aufgesogen.
Ein Dachs oder so was, schätzt Praiala. Oder ein Bär.
So sehr sie sich auch bemüht, sie kann sich keinen Bären vorstellen der solche Geräusche von sich gibt und sie weiß, dass es sich auch um ein dämonisches Wesen handeln könnte.
Leise greift die Geweihte nach dem Sonnenszepter, tritt aus dem Lichtschein und begibt sich leise ins Dunkel der Bäume um den vermeindlichen Eindringling zu überraschen. Doch sie kann nichts erkennen und das Geräusch ist auch nicht mehr zu hören.
Nach einer schieren Ewigkeit der Stille scheint die Geweihte schließlich überzeugt zu sein, dass keine Gefahr mehr besteht.